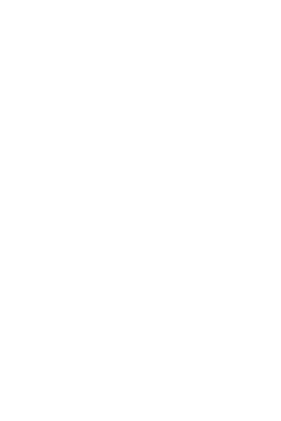Baden, Jägerbüchse (Offizier) 1793
Nur sehr wenige dieser Büchsen aus dem Ende des 18. Jahrhunderts haben überlebt, dies ist die einzige bekannte Offiziersversion.
Nussbaum-Vollschaft mit für den Anschlag günstiger Kolbenabsenkung und Backe links; kein Kolbenfach rechts, Lauf/Schaft-Verbindung durch Kreuzschraube, zwei Stifte/Ösen und Schraube des vorderen Riemenbügels; Alle Beschlagteile aus Messing, diese bestehend aus drei Ladestockröhrchen, vorderes und mittleres Röhrchen trichterförmig; oberer Riemenbügel kurz hinter dem Mündungsband durch den Schaft geschraubt, hinterer Riemenbügel an der Kolbenunterseite eingeschraubt. Flaches Steinschloss mit ebensolchem Schwanenhalshahn und einfacher Batteriedeckellagerung; Batteriefeder von der Schlossinnenseite her verschraubt „M. Martiny à Liège“ = Herstellersignatur auf der Schlossplatine unterhalb der Pfanne. Achtkantlauf, der sich in der Mitte verjüngt, zur Mündung hin aber an Stärke wieder zunimmt, „Rosette“ (Stöckel Marke Nr.1066) am Lauf links; Standvisier mit einer Klappe und Messingkorn, beide mit Schwalbenschwanzpassung. Eiserner Ladestock; Hirschfängerschiene bei der Mündung an die rechte Laufseite gelötet. Badische Krone am Kolben rechts und am Schlossgegenblech. „CF“ = Herrschermonogramm unter Fürstenhut auf Messingdaumenblech am Kolbenhals, leider nicht mehr erkennbarGesamtlänge 1105 mm, Lauflänge 719 mm, Kaliber des gezogenen Laufs 16,6 mm, Anzahl der Züge 7, Schlossplattenlänge 135 mm, Gewicht 3.717 g
Mit Beginn der Feldzüge gegen das revolutionäre Frankreich, in deren Verlauf die badischen Feldtruppen allmählich verstärkt wurden, kam es auch zur Aufstellung von Milizverbänden, welche von den wehrfähigen Landeseinwohnern im Alter vom 18. bis 50. Lebensjahr aufgeboten wurden. Beginnend mit dem Jahr 1792 wurden die wehrfähigen Männer verzeichnet, einzelne Abteilungen zur Unterstützung der regulären Truppen, die im Wachdienst am Rhein standen, ausgehoben, Abteilungen aus Freiwilligen errichtet und aus den Forstleuten des Landes ein besonderes Jägerkorps formiert, welches aus zwei Kompanien mit zusammen ca. 250 Mann bestand.Gemessen an der Gesamtstärke der Miliztruppen, die 10.500 Mann betrug, belief sich der Anteil des Jägerkorps lediglich auf 0,4 Prozent. Dies rührte daher, dass einerseits nur ein kleiner Teil von Leuten zur Verfügung stand, die im Umgang mit den schwierig zu ladenden Pflasterbüchsen geübt waren - größtenteils waren dies Forstleute , die zur Ausübung der Jagd auf präzise schießende Büchsen mit gezogenen Läufen angewiesen waren. Andererseits stand einem prozentual höheren Anteil an Jägertruppen dann die absolute Notwendigkeit entgegen, Büchsen im beträchtlichen Umfang beschaffen zu müssen, was mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden gewesen wäre, weil die Büchsen in ihrer Herstellung sehr arbeitsintensiv und daher teuer waren.Insgesamt sind heute noch sechs identische Jägerbüchsen bekannt, von denen vier von Thomas Wilhelm Pistor in Schmalkalden und zwei von J. C. Stöhr in Hanau gefertigt wurden. Die Bestellung der Büchsen in Schmalkalden und Hanau war insofern nicht ungewöhnlich, als die Markgrafschaft über keine eigenen Produktionsstätten verfügte – die Gewehrfabrik St. Blasien war zu diesem Zeitpunkt noch nicht etabliert – so dass es unumgänglich war, notwendige Waffen aus dem Ausland zu beziehen (in dieser Beziehung sollte die Firma Pistor in Schmalkalden kurze Zeit später eine wesentliche Rolle spielen). Notwendig aber dürfte die Beschaffung von Büchsen insofern gewesen sein, als bei Aufstellung des Jägerkorps sicherlich nicht jeder Mann seine eigene Waffe in die Truppe einbrachte, vielleicht auch nicht einbringen wollte, so dass der Fehlbestand auszugleichen war.Die hier gezeigte Büchse ist vom in Herstal bei Lüttich in den Jahren von 1769 bis 1793 nachweisbaren Büchsenmacher Martin Martiny gefertigt worden. Sie ist insgesamt deutlich aufwändiger verarbeitet, hat auch kein Kolbenfach, sodass davon auszugehen ist, dass diese Büchse auf Privatinitiative eines Offiziers der badischen Jägertruppe in Lüttich bestellt worden ist.