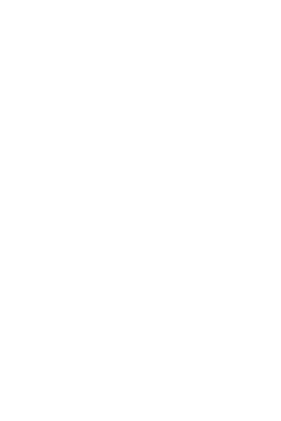Hessen-Darmstadt, Pistole 1731 der Garde de Dragons mit Monogramm Landgraf Ernst Ludwig 1678-1739
Nummer: F70
Hessen-Darmstadt, Pistole 1731 der Garde de Dragons mit Monogramm Landgraf Ernst Ludwig 1678-1739
5.350,00 €Dies ist eine der ältesten nachweisbaren Steinschlosspistolen aus der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt und heute von großer Seltenheit.
Nussbaum-Vollschaft mit ovalen Verschneidungen um Schloss und Schwanzschraubenblatt. Messingeschläge, diese bestehend aus zwei kanellierten Ladestockröhrchen, erhabenem Schlossgegenblech für zwei Schrauben und mit Fortsatz rechts, einteiligem Abzugsbügel und Kolbenkappe mit langen, seitlichen Sporen und Befestigungsschraube unten. Steinschloss mit leicht gewölbtem Schlossblech und ebensolchem Schwanenhalshahn; mit runder Eisenpfanne ohne Verbindungssteg zum Batterielager und Batterie mit Mittelgrat am Rücken der Schlagfläche; die Batteriefeder von der Schlossinnenseite her verschraubt. Der eiserne Abzug stark nach hinten eingerollt. Runder, am Pulversack auf 85 mm kantiger Lauf mit zwei Balustern und Herrschermonogramm „EL“ unter Krone. Marke „CB“ im Rechteck und zwei weitere undeutliche Marken an der Laufunterseite. Kimme in das Schwanzschraubenblatt eingefeilt, niedriges Eisenkorn 45 mm hinter der Mündung. Hölzerner Ladestock. Gesamtlänge 510 mm, Lauflänge 335 mm, Schlosslänge 133 mm, Länge Schlossgegenblech 132 mm, Kaliber des glatten Laufs 16,7 mm, Gewicht 1.029 g
Die Pistole zeigt leider nirgendwo einen Hinweis auf ihren Hersteller, weder das Schloss, noch der Lauf weisen eine Signatur auf, so dass die Feststellung, wer die Waffe gefertigt hat, nur hypothetisch möglich ist. Zunächst ist festzustellen, dass im in Frage kommenden Zeitraum eigentlich nur wenige, ausreichend leistungsfähige Hersteller den Waffennachschub für deutsche Truppen sicherstellten. Das war zum einen ab 1722 die preußische Gewehrfabrik Potsdam-Spandau sowie die Fabrikationszentren Lüttich, Suhl, Zella-St.Blasii und Essen. Wäre die Pistole in Potsdam produziert worden, könnte man dies sicherlich anhand dann vorhandener Stempelungen oder Signaturen leicht feststellen, auch eine Fertigung in Suhl, Lüttich oder Essen mit den bekannten, jeweils geschlagenen Stempelmarken könnte man sicherlich problemlos identifizieren. Eine Fertigung durch Johann Jakob Behr, wie dies bei zwei anderen, bekannten Darmstädter Pistole der gleichen Zeit nachgewiesen werden konnte, ist ebenso unwahrscheinlich, da entsprechende Hinweise an der Waffe fehlen. Auch Pistor in Schmalkalden kann keine Option sein, weil diese Manufaktur im fraglichen Zeitraum noch gar nicht existiert hat. So bleibt eigentlich nur noch die in der Nähe von Suhl gelegene Produktionsstätte Zella-St.Blasii. Tatsächlich findet sich an der Laufunterseite eine kleine, wenn auch ziemlich verwaschene und daher undeutliche Marke, die man mit etwas gutem Willen als zweizeiliges „ZEL“, also „ZE“ über „L“ deuten kann, welches so für Zella in den Jahren ab etwa 1710 nachweisbar ist. Das nur etwa 10 km von Suhl entfernte Zella St.Blasii gehörte zu dessen Einzugsgebiet und seine reichen Erzvorkommen bildeten schon im 16. Jahrhundert die Grundlage einer arbeitsteilig organisierten Waffenfabrikation. Im 18. Jahrhundert konzentrierte sich die Zellaer Tätigkeit besonders auf die Produktion von Militärwaffen, die nicht nur an das Gothaer Zeughaus geliefert wurden, sondern in erheblichem Teil auch ins Ausland. So kann man im norwegischen Heeresmuseum Akershus in Oslo noch heute einen größeren Bestand an in Zella St.Blasii gefertigten Militärwaffen finden, alles Infanteriegewehre, Gewehre, Jägerbüchsen, Karabiner und Pistolen aus den Produktionsjahren von 1711 bis etwa 1755. Sie alle tragen am Lauf, am Schwanzschraubenblatt oder am Schlossblech das für Zella St.Blasii typische, zweizeilige „ZEL“ und belegen somit die Leistungsfähigkeit der Büchsenmacherei in Zella St.Blasii im 18. Jahrhundert.